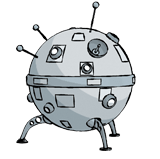Wirtschaft in der Französischen Revolution - das Ende des Merkantilismus
Vor der Französischen Revolution, in der Zeit des Absolutismus, verfolgte man in Frankreich eine Wirtschaftspolitik, die man Merkantilismus nennt. Für sein prunkvolles Leben, die immer größer werdende Zahl an Beamten und die Kriege, die er führte, brauchte der König nämlich viel Geld. Allein durch die Landwirtschaft kam aber nicht genug Geld in die Staatskasse.
Merkantilismus besagt, dass wenige Dinge im Ausland eingekauft werden, dafür aber viele Waren dann ins Ausland verkauft werden. Auf fertige Waren, die nach Frankreich hineinkommen sollten, wurden Zölle erhoben - nicht aber auf Rohstoffe, die dadurch billig waren und zudem oft aus den französischen Kolonien kamen. Diese Rohstoffe verarbeitete man dann in Manufakturen zu fertigen Waren, die teuer wieder ins Ausland verkauft wurden. Das waren zum Beispiel Teppiche, Kleidung oder Geschirr. Der Staat griff durch dieses Vorgehen sehr stark in die Wirtschaft ein, er lenkte sie.
Das Problem an dieser Art von Wirtschaftspolitik war aber nun, dass die große Masse des Volkes - der Dritte Stand - davon nichts hatte. Sie mussten hohe Steuern und Abgaben zahlen. Da sehr viele Menschen damals in der Landwirtschaft arbeiteten, hatten diese auch nichts von dieser Art der Wirtschaft, denn die Landwirtschaft spielte dabei keine Rolle. Nur wenige Menschen wie Kaufleute konnten im Merkantilismus selbst reich werden. So wuchs der Unmut im Volk, zumal die Preise für Lebensmittel immer weiter stiegen. Es gab viel Hunger und Armut. Es gab also wirtschaftliche Not im Volk und große soziale Ungleichheit. Das brachte Unruhen. Und so trug diese Wirtschaftspolitik auch zur Französischen Revolution bei.
Die Revolutionäre ergriffen Maßnahmen wie das Höchstpreisgesetz und die Verstaatlichung von Kirchenbesitz, um die Missstände zu beenden. Unter Napoleon kam es zur Gründung der Bank von Frankreich und der Kontinentalsperre, was ebenfalls wirtschaftliche Auswirkungen hatte.