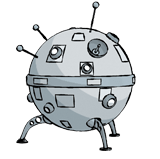Neue Verfassung: 5 Direktoren
Direktorialverfassung
1795 trat erneut eine neue Verfassung in Kraft: die Direktorialverfassung. Es war die nunmehr dritte Verfassung. Siehe auch: Worin unterscheiden sich die drei Verfassungen?
Wie kam es dazu? Nachdem zunächst die Thermidorianer mit dem Sturz Robespierres die Macht übernommen hatten, nahm die wirtschaftliche Not wieder zu. Die neue Regierung hatte das Höchstpreisgesetz aufgegeben, was zur Geldentwertung führte: Die Preise stiegen so sehr, dass man für das gleiche Geld immer weniger bekam. Nahrungsknappheit und Hunger sorgten für Unmut im Volk.
Die Direktorialverfassung 1795
Der Nationalkonvent verabschiedete am 22. August 1795 eine neue Verfassung. Diese Direktorialverfassung sah ein Zweikammersystem vor. Es bestand aus dem "Rat der Fünfhundert" und dem "Rat der Alten". Letzterer wählte als oberste Regierungsinstanz das Direktorium aus einer Vorschlagliste des Rates der Fünfhundert.
Das Direktorium war die Regierung, die "ausführende Gewalt" oder Exekutive. Es bestand aus fünf Personen. Die Direktoren blieben fünf Jahre im Amt. Jedes Jahr sollte einer der Direktoren neu gewählt werden. Der Vorsitz im Direktorium wechselte alle drei Monate. Man wollte damit verhindern, dass nur eine Person alle Macht auf sich vereinigte. Die wichtigsten Mitglieder im Direktorium wurden Lazare Carnot und Paul de Barras.
Gewaltenteilung und Zensuswahlrecht
Die neue Verfassung sah auch die Gewaltenteilung vor. Das Wahlrecht wurde wieder beschränkt und erneut daran gebunden, wie viele Steuern jemand zahlte. Das nennt man Zensuswahlrecht (abgeleitet von dem lateinischen Wort census = Steuereinschätzung). Die ärmere Bevölkerung war also von den Wahlen ausgeschlossen. Wer sich selbst wählen lassen wollte, musste ein noch viel größeres Vermögen besitzen. So kamen also nur reichere Männer ins Parlament.
Bedrohung der neuen Ordnung
Die neue Ordnung wurde von zwei Seiten bedroht. Auf der einen Seite standen die Sansculotten, die im Mai 1795 mit der Pariser Bevölkerung einen Aufstand versuchten, der aber niedergeschlagen wurde. Ebenfalls Anhänger einer Herrschaft des Volks war François Babeuf, der eine Verschwörung plante, die aber aufgedeckt wurde.
Auf der anderen Seite standen die Royalisten, Anhänger eines Königtums, die zur Monarchie zurückkehren wollten. Ein Aufstand dieser Seite wurde im Oktober 1795 ebenso wie im Herbst 1797 und Sommer 1798 niedergeschlagen.