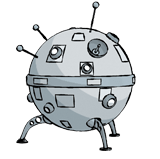Verstaatlichung während der Französischen Revolution

Als Nationalgüter bezeichnet man die Besitztümer, die während der Französischen Revolution verstaatlicht wurden und somit der "Nation" gehörten. Sie waren damit Nationaleigentum. Das nennt man auch Verstaatlichung.
Verstaatlicht wurde vor allem Eigentum der Kirche, wie Kirchen, Klöster und Land. Ein Antrag des Bischofs von Autun, Talleyrand, der in den Dritten Stand gewechselt war, setzte die Übernahme dieses Eigentums am 2. November 1789 durch.
Er meinte, dass die Geistlichen das Kirchenvermögen nicht wirklich besitzen, sondern nur zu verwalten hätten. Eigentlich wollte man aber vor allem die Schulden begleichen, die der Staat aus der Regierungszeit Ludwigs XVI. übernommen hatte.
Die Kirche verliert Boden
Der Staat verkaufte dann viele dieser ehemaligen kirchlichen Gebäude. Vor allem die Nebengebäude wurden häufig abgerissen und aus ihren Steinen wurden neue Gebäude, Straßen oder Brücken gebaut, während die Kirchen selbst stehen blieben. Die Nationalgüter wurden also häufig verkauft oder abgerissen. Die Rolle der Kirche wurde auch dadurch weiter zurückgedrängt.
Aber auch das Eigentum von einigen Adligen wurde eingezogen. Manche von ihnen flohen ins Ausland oder wurden während der Revolution enteignet und hingerichtet. Auch damit wurde das alte Adelssystem zerstört und eine neue gesellschaftliche Ordnung geschaffen.
Etwa 10 Prozent des Grundbesitzes in ganz Frankreich wechselte insgesamt zum Staat. Bei der Abstimmung waren 568 Abgeordnete dafür, den gesamten Besitz der französischen Kirche einzuziehen, 346 Abgeordnete stimmten dagegen. Um die Schulden des Staates zu verringern, gab man dann Schuldscheine aus, die Assignate. Die sollten durch den Verkauf des Kirchenbesitzes gedeckt sein. Allerdings wurden diese Schuldscheine bald wertlos, weil die Inflation immer stärker wurde.